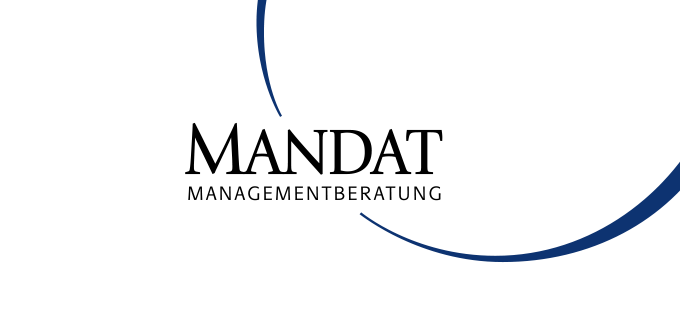30 Jahre Wachstumsberatung
Drei wesentliche Veränderungen aus über 500 Projekten in der Beratung von 250 Unternehmen und Organisationen zu profitablem Wachstum
Am 15. Juni 2019 feierte die Mandat Managementberatung GmbH mit Hauptsitz in Dortmund und Büros in London und New York ihr 30-jähriges Jubiläum. Der geschäftsführende Gesellschafter Professor Dr. Guido Quelle, der selbst als studentische Hilfskraft vor 29 Jahren bei Mandat begann, greift drei Themen auf, die sich über die Jahrzehnte wesentlich verändert haben. Und er ergänzt zwei Missverständnisse, die sich hartnäckig halten.
1. Strategie ist kein Unwort mehr
Der Begriff „Strategie“ stand früher nicht im besten Ruf. Noch in den 1990er-Jahren war allein das Wort geeignet, verbreitet hochgezogene Augenbrauen hervorzurufen bis hin zu deutlicher Abwehr im Mittelstand. „Strategie“ galt als Unwort und wurde als Domäne der Berater angesehen, denen unterstellt wurde, vor allem Papier produzieren und hohe Honorare abrechnen zu wollen.
Heute ist die Erkenntnis, dass eine gute Strategie unerlässlich für gesundes Wachstum ist, auch im Mittelstand angekommen. Nur noch wenige Unternehmen behaupten, Strategie sei unnötiger Luxus – frei nach dem Motto „Wir brauchen keine Strategie, wir brauchen Umsatz“. Im Gegenteil: Gerade im Mittelstand wird die Erfordernis einer guten Strategie heute anerkannt. Besonders im gehobenen Mittelstand ist inzwischen die Bereitschaft groß, sich strukturiert über die Zukunft Gedanken zu machen. Die Akteure bleiben dabei nicht auf der konzeptionell-beschreibenden, der intellektuellen Ebene stehen, sondern sie denken sofort daran, wie sie Konzepte in Handlungen und Prozesse übertragen und so den Erfolg sichern können.
Auch, wenn der Mittelstand also längere Zeit gebraucht hat, um sich mit konzeptioneller Arbeit anzufreunden – gegenüber Großunternehmen hat er einen Vorteil: Die Geschwindigkeit, in der sich Projekte umsetzen lassen. Das ist ein großer Vorteil. Ist eine Strategie erst einmal in ein Wachstumsprojekt übersetzt, gibt es meist kein Halten mehr – im positivsten Sinne.
2. Sinnvolle Führung geschieht heute anders
Früher war Zusammenarbeit einfacher. Im „System des Patriarchen“ wies der Chef (oder seltener die Chefin) etwas an, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten es aus und das Resultat wurde dann wieder von „oben“ begutachtet und abgenommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten – plakativ gesprochen – einfach die Anweisung des Chefs ausführen und konnten sich dann zurücklehnen, nach dem Motto „Die Fenster sind gestrichen, Chef, was machen wir jetzt mit den Rahmen?“. Manche sehnen sich nach dieser direkten Führung zurück.
Aber dieses sternförmige Muster funktioniert nicht mehr, wenn Unternehmen wirklich gesund und profitabel wachsen wollen. Dazu finden Entscheidungsprozesse heute vielfach in zu komplexen Umfeldern statt. Es rücken Unternehmer und Manager nach, die ganz anderes Arbeiten gewohnt sind, und darüber hinaus hat der Informationsgrad von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stark zugenommen. Diese wollen zudem mehr gefordert werden – was in der öffentlichen Diskussion oft zu kurz kommt. Sie wollen eingebunden, gehört, beteiligt werden.
Das bedeutet nicht, dass die Entscheidungserfordernis in der Unternehmenslenkung abnimmt, ganz im Gegenteil, aber die Erfordernis des multidisziplinären Arbeitens hat enorm zugenommen. Darin ist allerdings auch eine Gefahr verborgen: nämlich, dass Entscheidungen verzögert oder demokratisiert werden. Hier ist die heutige Unternehmensspitze gefordert. Es gilt, das Zuhören irgendwann zu beenden und dann eine Entscheidung zu treffen und zwar nicht basisdemokratisch, sondern auf der Ebene, wo die Entscheidung auch final getroffen werden kann.
3. Die Arbeit der Berater hat sich verändert
Mit dem unter 1) erwähnten Punkt der Umsetzungserfordernis korrespondiert eine weitere Entwicklung. Berater, die früher vielfach als „Wissende“ zur Analyse und Begutachtung eingesetzt wurden, müssen heute deutlich resultatsbezogener arbeiten. Hinzu kommen zwei weitere Punkte, die die Zusammenarbeit nachhaltig verändert haben. Erstens sind Informationen heute wesentlich schneller und in höherer Qualität und Aktualität weltweit verfügbar. Konnte sich ein Berater früher noch mit Informationsrecherchen, die über sehr teure, minutenweise abgerechneten Datenbanken auf langsamen Datenwegen durchgeführt wurden, profilieren, hat ein Klientenunternehmen heute die gleichen Möglichkeiten, wie ein Berater – einmal abgesehen von unternehmens- und branchenübergreifendem Projekt-Know-how, das Berater verfügbar machen können. Zweitens hatten Beratungsgesellschaften einen Vorteil bei der visuellen Aufbereitung wichtiger Unterlagen für Aufsichtsrats- und Vorstandssitzungen, dem so genannten Desktop Publishing. In den Sekretariaten der Unternehmensleiter beherrschte das schlicht nahezu niemand. Heute jedoch sind Powerpoint & Co. selbstverständlich auf jedem Rechner installiert – und werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt.
Was sich aber signifikant verändert hat, ist die Anforderung an die Zusammenarbeit mit den Beteiligten in den Klientenunternehmen. Insbesondere im gehobenen Mittelstand, aber auch in Großunternehmen erwarten Klienten, dass die Berater zusammen mit ihnen Dinge erarbeiten, und zwar nicht als überbezahlte Sachbearbeiter, sondern punktuell und wirkungsvoller als in der täglichen Routine. Sie erwarten zudem zumindest die Möglichkeit, dass eine beschlossene Strategie oder entsprechende Maßnahmen später auch gemeinsam umgesetzt werden. Der Berater kann sich also nicht einfach nach der abschließenden Präsentation verabschieden. Zwar nutzt nicht jeder Klient diese Option, aber sie sollte vorhanden sein. Es wird auch eine wesentlich größere Akzeptanz des Beraters im Unternehmen vorausgesetzt als früher, weil dies der Akzeptanz der gemeinsam erarbeiteten Resultate maßgeblich dient.
Wie unter 2) beschrieben haben sich die Entscheidungsprozesse in den Klientenunternehmen stark verändert. Je größer das Unternehmen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein formeller Ausschreibungsprozess in Gang gesetzt wird – meist über eine Einkaufsabteilung. Diese Entwicklung ist aus mehreren Gründen wenig hilfreich. Erstens muss ein Berater schon aus berufsethischen Gründen die Möglichkeit haben, vor Angebotsabgabe mit dem echten Entscheider zu sprechen. Zweitens sollte ein Unternehmen dem Berater nicht vorgeben, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Und drittens ist die unvermeidliche Frage nach der Reduktion des angebotenen Honorars schlicht unseriös.
4. Etwas, das sich nicht geändert hat: Die Verwendung von „Buzzwords“
Was haben Business Process Reengineering, Gemeinkostenwertanalyse, Marktanteils-/Marktwachstumsmatrix und Balanced Score Card gemeinsam? Es handelt sich um Methoden, die von Beratern erfunden wurden und die als Schlagworte durch die Welt der Unternehmensführungen geistern. Ein paar Beispiele: In den 1990er-Jahren wurde Reengineering nahezu überall durchdekliniert. Leider wurde der Faktor „Führung“ dabei vergessen. Anfang der 2000er-Jahre gab es zahlreiche Unternehmen, die die Balanced Score Card bis ins Detail in die Funktionsbereiche übertrugen. Und heute dreht sich alles um agiles Handeln. Vorsicht vor Schlagworten, Platzhaltern und fast schon religiös vorgetragenen Beratermethoden ist auch heute geboten.
Die relevante, wachstumsorientierte Frage ist aber nicht die nach der richtigen Methode, sondern die nach dem richtigen Resultat. Die Methode darf auch heute nur Mittel zum Zweck sein, nie Zweck an sich. Es gibt immer mehrere Methoden, die zum Ziel führen. Hat eine Methode aber erst Kultstatus erreicht, gerät das Ziel nicht selten aus den Augen. Auch heute gibt es noch solche Buzzwords, die fast schon Kultstatus haben: Design Thinking, Rapid Prototyping (hält sich immer noch), Scrum oder alles rund um „agile Unternehmen“, die Liste lässt sich fortsetzen.
Methoden sind wichtig, aber sie dürfen das Ziel nicht dominieren. Eine Methode muss sich stets dem Ziel unterordnen, wenn sie wachstumsfördernd wirken soll.
5. Trendthema Digitalisierung? Gibt es schon seit 30 Jahren
Das Thema Digitalisierung ist derzeit in aller Munde: Industrie 4.0, vernetztes Arbeiten, disruptive Geschäftsmodelle sind die dazugehörenden Buzzwords. Dabei gibt es Digitalisierung schon seit dreißig Jahren. Die Einführung des Personal Computers und damit die Abkehr vom Mainframe-Rechner, einhergehend mit einer arbeitsplatzorientierten Demokratisierung der elektronischen Welt? Das war Digitalisierung. Die Möglichkeit, selbst Dokumente zu erstellen, für die man zuvor eine Agentur benötigte, also eine neue Wertschöpfungsstufe am Arbeitsplatz? Digitalisierung. Die flächendeckende Möglichkeit, mit dem Internet auf Informationen weltweit zuzugreifen und damit einen ganz neuen Informationsstand zu erreichen? Digitalisierung. E-Mails in Sekundenschnelle durch die Welt zu jagen und die damit verbundenen neuen Anforderungen an Geschäftsprozesse und Geschwindigkeit? Digitalisierung par excéllence.
Wir leben seit Jahrzehnten in einer zunehmend durch Informationstechnologie bestimmten Welt – und das wird sich fortsetzen. Es geschieht nicht linear, sondern – dem Verlauf vieler Wachstumskurven folgend – auf einer Exponentialkurve. Das lernen wir weder in der Schule noch auf der Hochschule – und darum fällt es uns schwer, mit der so genannten „digitalen Revolution“ umzugehen. Dabei gab es schon mehrere „kleine“ Revolutionen: Vielleicht erinnert sich der eine oder die daran, dass sie lieber die gewohnte und bekannte Adler-Schreibmaschine genutzt haben, als dem fremden PC zu vertrauen. Dass sie Daten von einer Tabelle in die nächste abgetippt haben, anstatt sie zu kopieren und einzufügen. Dass der Taschenrechner zum Berechnen einer Excel-Tabelle herausgeholt wurde, weil sie die Formeln nicht beherrschten. Und natürlich an die Botschaft, die Einführung des PC würde hunderttausende Jobs kosten. Eine Reaktion auf neue Lösungen, die einem doch irgendwie bekannt vorkommt.
Digitalisierung ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie ein Platzhalter, ein hinreichend breit gewähltes Schlagwort, die gesellschaftliche Debatte prägen kann, ohne dass definiert ist, was darunter verstanden wird. Was also ist Digitalisierung? Digitalisierung muss verstanden werden als durch Informationstechnologie ermöglichte Innovation. So wird der Begriff anfassbarer.
Wir brauchen keine Angst zu haben vor der sogenannten Digitalisierung, sondern sollten die Chancen sehen. Das ist im Übrigen eine wesentliche wachstumsfördernde Eigenschaft, die sich über Jahre und Jahrzehnte gehalten hat und halten wird: die Chancen sehen und die Risiken im Auge behalten, statt die Risiken dafür zu nutzen, die Chancen zunichte zu machen.